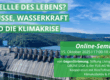Obwohl sie rein der Begrifflichkeit nach harmlos klingen: „Kleinwasserkraftwerke“ und „Kleinstwasserkraftwerke“, deren mutmaßliche Harmlosigkeit ist in Amazonien keine Selbstverständlichkeit – im Gegenteil. Die Menschenrechtsorganisation Operação Amazônia Nativa (OPAN) hat für das Wassereinzugsgebiet des Tapajós-Zuflusses Juruena eine neue Studie vorgelegt und diese zeigt den massiven Anstieg an vermeintlich „kleinen“ Wasserkraftprojekten in der untersuchten Region in den vergangenen sechs Jahren und offenbart, was dies für soziale und Umweltfolgen für die dort am, vom und mit dem Fluss lebenden Indigenen Völkern hat.
Um gleich sprachlichen Missverständnissen vorzubeugen, was dem/der einen als „klein“ erscheint, ist andernorts machmal „groß“ und umgekehrt. Dies gilt auch für Wasserkraftwerke. Denn es gibt keine international gültige Definition eines „Kleinwasserkraftwerks“. Was als Kleinwasserkraftwerk zählt, variiert von Fall zu Fall. Laut der International Commission on Large Dams sind alle Staumauern ab 15 Metern Höhe vom Fundament bis zur Krone oder von 5 bis 15 Metern mit einem Reservoir von mehr als drei Millionen Kubikmetern Großstaudämme. In vielen Ländern wird dagegen eine Megawattzahl zur Klassifizierung herangezogen: In der Regel werden demnach Kraftwerke bis 10 MW Nominalkapazität als Kleinwasserkraftwerke angesehen, von 10 bis 30 MW gelten sie als mittelgroße Kraftwerke. Länder mit besonders hohem Wasserkraftpotenzial wie Brasilien und China betrachten dagegen alle Kraftwerke bis 30 MW als „klein“. Im besonderen Falle Brasiliens muss zudem noch unterschieden werden zwischen „Kleinwasserkraftwerken“ und „Kleinstwasserkraftwerken“. „Kleinstwasserkraftwerke“ heißen in Brasilien CGH – Central Geradora Hidrelétrica, die haben eine installierte Leistung von bis zu 5 MW. „Kleinwasserkraftwerke“ heißen in Brasilien PCH – Pequena Central Hidrelétrica, und die haben eine installierte Leistung von 5 bis 30 MW. Zum Vergleich: In Österreich zählt alles als Kleinwasserkraftwerk, solange die Leistung weniger als 10 MW beträgt. In Deutschland sagt die Definition eines Kleinwasserkraftwerkes, dass es sich dabei um ein solches handelt, wenn es weniger als 1 MW Leistung erzielt. Und ein 30-MW Wasserkraftwerk wäre in Deutschland eines der großen Wasserkraftwerke, in Brasilien zählt ein solches noch zu den Kleinen.
Werden in Brasilien Wasserkraftwerke als „kleinst“ oder „klein“ eingestuft, dann kann das teils deutliche Vereinfachungen bei dem rechtlichen Genehmigungsprozess bedeuten. So sind Kleinstwasserkraftwerke und Kleinwasserkraftwerke oftmals von der Erstellung der diversen rechtlich geforderten Umweltgenehmigungsstudien befreit, da sie ja als „harmlos“ oder „wenig schädlich“ gelten, sie sind ja nur „klein“. Und oft ist für die Genehmigung bei den „kleinen“ oder „kleinsten“ dann nur die Landesbehörde zuständig, deren Prüfungsmodalitäten zudem leichter, sprich: unternehmensfreundlicher sind – das Narrativ der vermeintlichen Entbürokratisierung hat hier ganze Arbeit geleistet.
Vorherige Studien in Amazonien haben gezeigt, wie auch (die vermeintlich harmlosen) Kleinwasserkraftwerke die Wanderzyklen aquatischer Arten beeinträchtigen und die Lebensweise Indigener Völker bedroht werden, die für ihre Ernährung, ihre Kultur, ihren Transport und ihre Mobilität und für ihren Lebensunterhalt direkt von diesem Ökosystem fließender und lebendiger Fluss abhängig sind. So zeigt sich in Amazonien oft, wie auch Kleinstwasserkraftwerke oder Kleinwasserkraftwerke erhebliche Auswirkungen auf die aquatische Biodiversität haben: denn die Fragmentierung der Flussabschnitte durch auch kleine Wehre und Staumauern behindert potentiell den Wanderungszyklus der Fische, verändert oft die Sauerstoffgehalt des Wassers, die Temperatur, die Fließgeschwindigkeit, die Sedimentfracht und die im Fluss vorhanden Nährstoffe, alles was potentiell enorm zu einem deutlichen Rückgang der Fischbestände in ehemals fischreichen Flüssen beitragen kann, wenn die Kontinuität der natürlichen Fluss-Strömungen beeinträchtigt wird und somit die Fortpflanzung und Wanderung der Arten gestört wird, was letztlich zu Fischmangel und zur Zerstörung empfindlicher Ökosysteme führen kann – und leider oft führt.
Die brasilianische Menschenrechtsorganisation Operação Amazônia Nativa (OPAN) hat nun für das Wassereinzugsgebiet des Tapajós-Zuflusses Juruena diese neue Studie vorgelegt und zeigt einerseits einen massiven Anstieg an vermeintlich „kleinen“ Wasserkraftprojekten in der untersuchten Region in den vergangenen sechs Jahren und deckt schonungslos deren soziale und Umweltfolgen auf – obwohl es ja „nur“ kleine oder kleinste Wasserkraftwerke seien.
Die neue Analyse von OPAN, die den Zeitraum von Januar 2024 bis Juli 2025 umfasst, identifizierte insgesamt 185 Wasserkraftwerke im Juruena-Becken. Davon sind 48 % CGHs (Kleinstwasserkraftwerke) und 39 % PCHs (Kleinwasserkraftwerke), was eine klare Tendenz zu kleineren Projekten zeigt, die trotz ihrer kleinen Größe dennoch erhebliche Risiken mit sich bringen. Die Studie zeigt, dass sich 66 % der Projekte noch in der Planungsphase befinden, was auf ein beträchtliches weiteres Wachstumspotenzial für Wasserkraftwerke in den kommenden Jahren hindeutet, so OPAN in ihrer Studie.
Einer der Punkte, der laut OPAN größten Anlass zur Sorge gibt, sei eben das Wachstum der Kleinwasserkraftwerke (PCHs), deren Zahl im Einzugsgebiet zwischen 2019 und 2025 von 42 auf 88 Anlagen mehr als verdoppelt wurde. Diese rasante Expansion stehe in direktem Zusammenhang mit der Vereinfachung der Regulierungsverfahren durch die Nationale Elektrizitätsagentur Aneel im Jahr 2020 (unter der Regierung Bolsonaro), die diese „kleineren“ Projekte von eingehenderen Studien wie der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und dem Umweltverträglichkeitsbericht (RIMA) befreit hat. Stattdessen unterziehen sich die CGHs häufig einem vereinfachten Umweltbericht, der als oberflächlicher und unzureichend für die Bewertung der sozialen und ökologischen Risiken in sensiblen Gebieten angesehen wird, so OPANs Kritik.
Die OPAN-Studie warnt vor einem Szenario zunehmenden Drucks auf indigene Gebiete im Juruena-Becken, der durch den Ausbau der Wasserkraft vorangetrieben werde. Die zügige Erteilung von Genehmigungen, die mögliche Unterschätzung der Auswirkungen und die Schwächung des Rechts auf vorherige Konsultation (FPIC) der betroffenen Indigenen Völker sind Punkte, die die dringende Aufmerksamkeit von Umweltbehörden, Behörden und der Zivilgesellschaft erfordern, um den Schutz der Gebiete und Rechte der indigenen Völker zu gewährleisten, so OPAN. Denn die Folgen der Abwesenheit einer Umweltverträglichkeitsstudie ist laut der Studie oft, dass die realen Konsequenzen von „Kleinwasserkraftwerken“ und „Kleinstwasserkraftwerken“ für die lokal vor Ort lebenden Indigenen Völker wie Fischschwund, Änderung des Fließgewässers und der Sedimentfracht u.v.a.m. ebenso wenig beachtet werden, wie Fragen, welche Konsequenzen eine Kaskade von Kleinstwasserkraftwerken hintereinander für die lokale Flora und Fauna und mithin für die Menschen vor Ort bedeutet. Der Studie zufolge sind im Juruena-Einzugsgebiet die synergistischen und kumulativen Auswirkungen des Booms der „Klein“-Wasserkraft vor Ort auf die aquatischen Ökosysteme bereits jetzt offensichtlich – und OPAN fürchtet, dass der Ausbau der Wasserkraft, ob kleinst, klein, mittel oder groß, in Amazonien weitergehen wird. Und dass die davon betroffenen Indigenen Völker weiterhin nicht angemessen konsultiert werden.




![Belo Monte. Foto: christian russau [2016]](https://www.gegenstroemung.org/wp-content/uploads/2018/02/DSCN7237-110x80.jpg)

![Flusswasser des Rio Doce nach dem Dammbruch der Samarco. Foto: christian russau [2016]](https://www.gegenstroemung.org/wp-content/uploads/2024/10/03-TI-Krenak-Wasser-2-scaled-110x80.jpg)